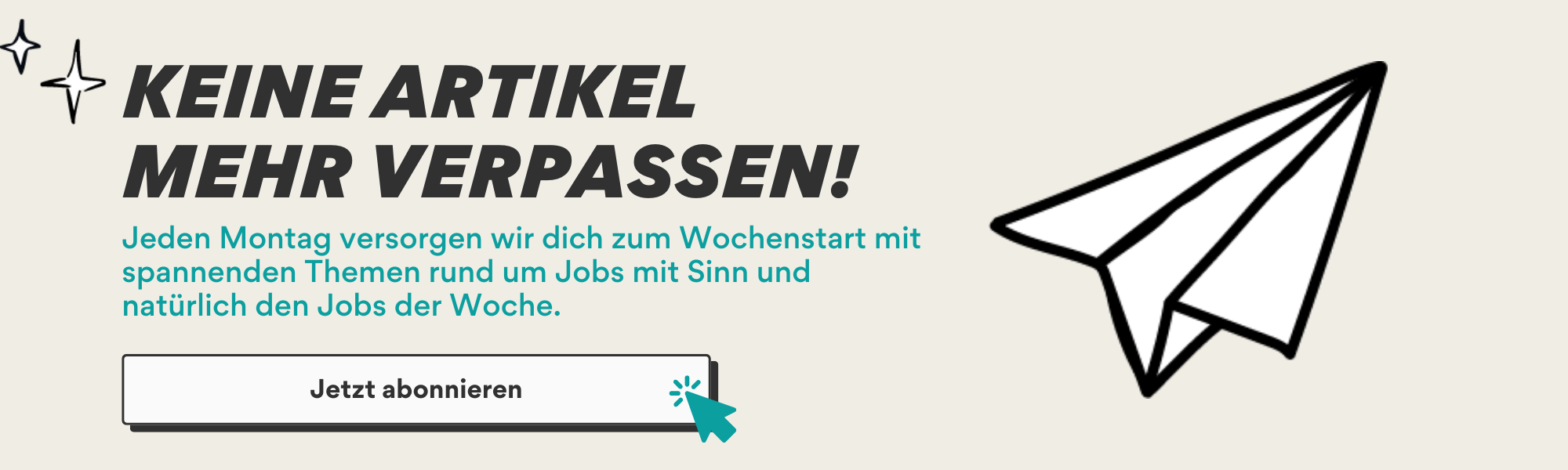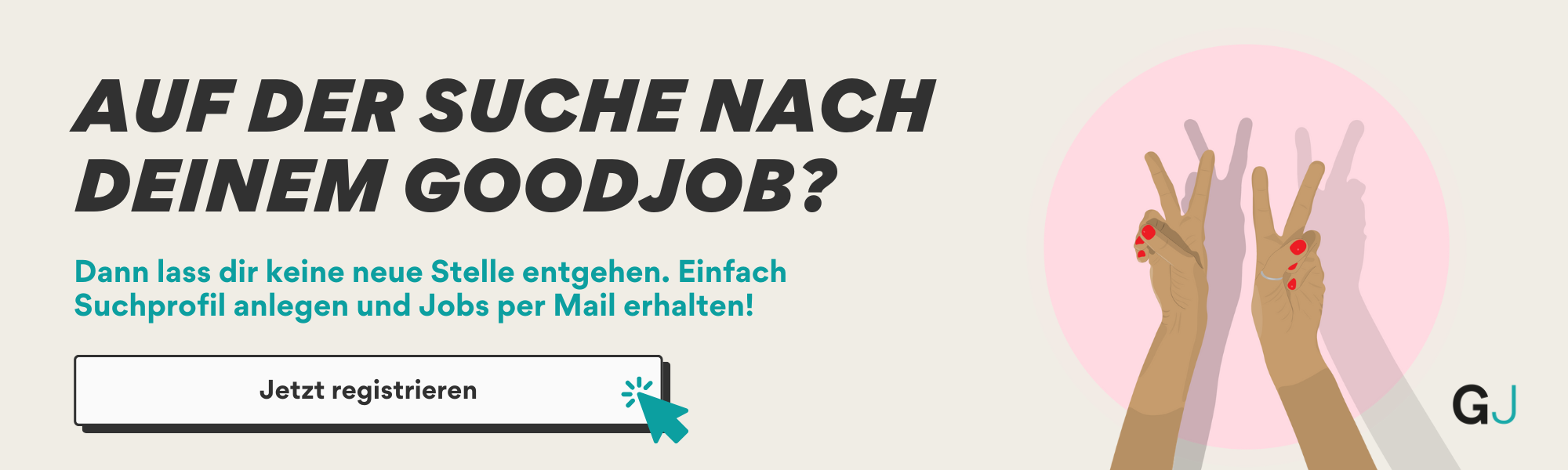Warum das Hochstapler-Syndrom so viele von uns betrifft – und wie wir es überwinden können
„Hoffentlich merken die anderen nicht, dass ich gar nicht so gut bin.“ Kommt dir das bekannt vor? Erfahre, warum das Hochstapler-Syndrom so verbreitet ist, welche Ursachen es hat und wie du deine Selbstzweifel Schritt für Schritt loswerden kannst.

© Polina Zimmerman via Pexels
Das Hochstapler-Syndrom: Ein Gefühl, das viele kennen
„Wenn die wüssten, dass ich das alles nur spiele …“ Dieser Gedanke begleitet viele Menschen durch ihren beruflichen Alltag – unabhängig von ihren Erfolgen, ihrer Erfahrung oder ihrem Bildungsgrad. Das Hochstapler-Syndrom beschreibt das Phänomen, trotz objektiver Qualifikationen und Erfolge an den eigenen Fähigkeiten zu zweifeln. Betroffene fürchten, früher oder später „entlarvt“ zu werden, weil sie glauben, ihrem Erfolg nicht gerecht zu werden.
Interessanterweise sind es oft diejenigen, die besonders leistungsfähig und engagiert sind, die sich selbst am meisten infrage stellen. Das Phänomen betrifft Menschen aller Geschlechter, doch insbesondere Frauen und Angehörige marginalisierter Gruppen leiden häufiger unter diesen Gefühlen. Doch warum ist das so?
Gesellschaftliche Wurzeln: Warum Selbstzweifel kein Zufall sind
Die Ursache des Hochstapler-Syndroms liegt nicht nur in der Persönlichkeit einer Person. Gesellschaftliche Strukturen und Erwartungen spielen dabei eine zentrale Rolle. Schon früh lernen Kinder, wie sie sich verhalten „sollen“. Jungen wird oft beigebracht, mutig, laut und wettbewerbsorientiert zu sein, während Mädchen für Empathie, Bescheidenheit und Fürsorglichkeit gelobt werden.
Das zeigt sich auch in der Wahl von Spielsachen: Während Mädchen Puppen und Spielküchen erhalten, die Rollenspiele fördern, werden Jungen zu Abenteuern mit Bauklötzen und Fahrzeugen ermutigt. Diese Rollenbilder setzen sich später in der Arbeitswelt fort. Diejenigen, die selbstbewusst auftreten und ihre Erfolge sichtbar machen, werden belohnt, während Bescheidenheit oft übersehen wird.
Ein weiteres Problem sind die zusätzlichen Hürden, die marginalisierte Gruppen überwinden müssen. Diskriminierung und Vorurteile führen dazu, dass Menschen marginalisierter Gruppen mehr leisten müssen, um die gleiche Anerkennung zu erhalten. Diese Erfahrungen verstärken das Gefühl, dass man sich seinen Platz „ergaunert“ hat, auch wenn das nicht der Realität entspricht.
Ein historisches Phänomen: Nicht neu, aber immer noch aktuell
Das Hochstapler-Syndrom ist kein modernes Problem. Schon 1978 beschrieben die Psychologinnen Pauline R. Clance und Suzanne A. Imes dieses Phänomen erstmals in ihrer Forschung. Sie stellten fest, dass viele beruflich erfolgreiche Frauen ihre Erfolge nicht auf ihre eigene Leistung zurückführten, sondern auf Glück, Zufall oder äußere Umstände. Diese Muster wiederholen sich bis heute – und betreffen längst nicht nur Frauen.
Clance entwickelte später die „Imposter Phenomenon Scale“, die verschiedene Ausprägungen des Syndroms erfasst. Zu den typischen Verhaltensweisen gehören unter anderem:
👉 Der Drang, übermäßig viel zu leisten, um eigene Zweifel zu kompensieren.
👉 Das Gefühl, ständig beweisen zu müssen, dass man „dazu gehört“.
👉 Die Angst, bei kleinsten Fehlern als inkompetent entlarvt zu werden.
👉 Schwierigkeiten, Lob anzunehmen oder eigene Erfolge als verdient anzuerkennen.
Das alles trägt dazu bei, dass Betroffene sich ständig selbst unter Druck setzen – oft bis zur Erschöpfung.
Wie sich das Hochstapler-Syndrom äußert
Die Symptome des Hochstapler-Syndroms sind vielfältig und reichen von Selbstzweifeln bis hin zu belastenden Ängsten. Viele Betroffene fühlen sich nur dann „sicher“, wenn sie perfekt sind, und setzen sich selbst unerreichbare Standards. Gleichzeitig fällt es ihnen schwer, ihre Leistungen realistisch einzuschätzen.
Ein Beispiel: Eine Person, die regelmäßig positive Rückmeldungen zu ihrer Arbeit erhält, könnte dennoch glauben, dass ihre Kolleg*innen oder Vorgesetzten einfach „nicht bemerkt haben, wie schlecht sie wirklich ist“. Lob wird als unangenehm empfunden, weil es die Angst verstärkt, den gestiegenen Erwartungen nicht gerecht zu werden.
Diese Gedankenmuster können nicht nur das Wohlbefinden beeinträchtigen, sondern auch die berufliche Entwicklung hemmen. Denn wer an sich selbst zweifelt, zögert oft, neue Herausforderungen anzunehmen oder sichtbar für eigene Erfolge einzustehen.
Gesellschaftliche Auswirkungen: Warum das Hochstapler-Syndrom auch Unternehmen betrifft
Das Hochstapler-Syndrom ist nicht nur ein individuelles Problem – es betrifft auch Unternehmen und Organisationen. Betroffene Mitarbeitende schöpfen oft nicht ihr volles Potenzial aus, weil sie sich durch Selbstzweifel zurückhalten oder übermäßig vorsichtig agieren. Gleichzeitig führt die ständige Angst, „entlarvt“ zu werden, zu Stress, Überarbeitung und im schlimmsten Fall zu Burnout.
Für Unternehmen bedeutet das nicht nur, dass ihre Mitarbeitenden oft unter ihrem Potenzial bleiben und sich weniger entfalten können – auch ihre psychische und physische Gesundheit leidet unter dem konstanten Druck und den Selbstzweifeln und kann zu höheren Kosten durch krankheitsbedingte Ausfälle und Fluktuation führen.
Die Folgen können Erschöpfung, Burnout oder ein Rückzug aus dem Berufsleben sein. Organisationen haben hier die Chance, nicht nur Strukturen zu schaffen, die Selbstzweifel abbauen, sondern auch ein Umfeld zu fördern, in dem sich Menschen wohlfühlen, wertgeschätzt werden und ihr volles Potenzial entfalten können.
Indem Unternehmen die Bedürfnisse ihrer Mitarbeitenden in den Mittelpunkt stellen, profitieren letztlich alle – die Menschen, das Team und das Unternehmen selbst.
Was Unternehmen tun können: Lösungsansätze im Überblick
🎯 Klare Ziele und Erwartungen:
Transparenz ist entscheidend. Wenn Mitarbeitende genau wissen, was von ihnen erwartet wird, können sie ihre Leistung realistischer einschätzen. Regelmäßige Feedbackgespräche helfen dabei, Unsicherheiten zu reduzieren und ein gemeinsames Verständnis für Erfolge zu schaffen.
🎨 Eine positive Fehlerkultur:
In vielen Unternehmen wird Perfektionismus gefördert, was das Hochstapler-Syndrom verstärken kann. Eine offene Fehlerkultur, die Scheitern als Teil des Lernprozesses anerkennt, gibt Mitarbeitenden die Freiheit, auch ohne Angst vor Kritik neue Dinge auszuprobieren.
💡 Weiterbildungen und Coaching:
Durch gezielte Weiterbildungsmöglichkeiten können Unternehmen nicht nur die fachlichen Kompetenzen ihrer Mitarbeitenden fördern, sondern auch deren Selbstvertrauen stärken. Mentoring-Programme oder Coachings können zusätzlich dazu beitragen, individuelle Stärken sichtbar zu machen.
🙏 Eine wertschätzende Arbeitskultur:
Regelmäßiges, ehrliches Feedback – sowohl konstruktiv als auch positiv – ist essenziell, um das Selbstwertgefühl der Mitarbeitenden zu fördern. Wer das Gefühl hat, für seine Arbeit gesehen und geschätzt zu werden, zweifelt seltener an sich selbst.
Was du selbst tun kannst: Schritte aus der Selbstzweifel-Spirale
Auch wenn das Hochstapler-Syndrom oft durch äußere Einflüsse verstärkt wird, gibt es Strategien, die dir helfen können, Selbstzweifel zu überwinden:
📝 Führe ein Erfolgstagebuch:
Notiere dir jeden Tag mindestens eine Sache, die dir gut gelungen ist. Das kann eine gelöste Aufgabe, ein Kompliment oder ein persönlicher Fortschritt sein. Mit der Zeit wirst du erkennen, wie viel du tatsächlich erreichst – auch, wenn es dir anfangs nicht so erscheint.
🥰 Lerne, Lob anzunehmen:
Wenn dir jemand ein Kompliment macht, widerstehe der Versuchung, es zu relativieren („Das war doch nichts Besonderes“). Übe stattdessen, einfach „Danke“ zu sagen und das Lob anzunehmen.
🪞 Vermeide Vergleiche:
Jeder hat unterschiedliche Stärken und Schwächen. Anstatt dich mit Kolleginnen und Kollegen zu vergleichen, konzentriere dich auf deine eigenen Fähigkeiten und darauf, was du einzigartig gut kannst.
🫂 Hole dir Unterstützung:
Wenn du merkst, dass dich die Selbstzweifel stark belasten, suche dir Unterstützung – sei es durch einen Coach, eine Therapeutin oder einen Therapeuten oder einen vertrauensvollen Austausch mit Freundeskreis. Oft hilft es, die eigene Perspektive durch Feedback von außen zu verändern.
Gemeinsam gegen Selbstzweifel
Das Hochstapler-Syndrom mag weit verbreitet sein, doch es ist kein unausweichliches Schicksal. Indem wir gesellschaftliche Strukturen hinterfragen, Unternehmen gezielt Maßnahmen ergreifen und individuell an unserem Selbstwert arbeiten, können wir lernen, unsere Erfolge anzuerkennen.
Denn niemand sollte das Gefühl haben, sich seinen Platz oder Erfolg „erschlichen“ zu haben. Deine Leistungen sind das Ergebnis deines Einsatzes, deiner Fähigkeiten und deiner Stärke. Es ist an der Zeit, den inneren Kritiker*innen mit Klarheit und Zuversicht zu begegnen. Mach dir bewusst, was du schon erreicht hast, und erkenne deinen Wert an. Deine Stärken sind real und verdienen es, gesehen und gelebt zu werden.
Über die Autorin:

Jannike Stöhr ist Karriere-Coach und Autorin. Sie begleitet Menschen dabei, Selbstzweifel zu überwinden und berufliche Erfüllung zu finden. Ihr Newsletter „3 Minuten für deine Karriere“ liefert wöchentlich kurze, inspirierende Impulse, die dir helfen, dich beruflich und persönlich weiterzuentwickeln.
Diese Artikel könnten dich auch interessieren:
😍 Sinnerleben im Job: Diese 4 Aspekte müssen erfüllt werden
😵💫 Imposter-Syndrom: Hilfe, ich bin ein*e Hochstapler*in
🥹 Hochsensbilität im Beruf: Eine Orientierungshilfe